von Rainer Molzahn
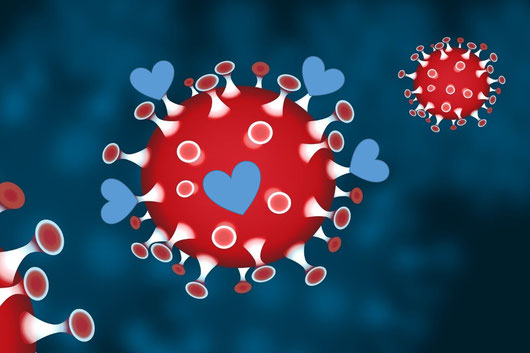
Gerade waren die letzten Seiten des Manuskripts ‚Transformatives Coaching‘ geschrieben ... da trat die Pandemie namens Corona in unser Leben.
Sie fordert uns alle heraus. Als Individuen wie als Gemeinschaften.
Was können wir tun im Angesicht der Krise unserer überkommenen Antwort auf die Frage "wie lebt man"?
Dieser Beitrag ist der Epilog des Buches - ein Statusbericht aus dem Lagezentrum.
Gerade waren die letzten Seiten des Manuskripts ‚Transformatives Coaching‘ geschrieben, das in den nächsten Wochen erscheinen wird. Im letzten Abschnitt hatten wir summiert, was uns in diesen Zeiten individuell wie gemeinsam konfrontiert, was uns unterscheidet und was uns verbindet, und wozu wir uns infolge all dessen aufgerufen fühlen. Und wir hatten in den letzten Sätzen auf den Nenner gebracht, worin wir im Wandelforum unseren Beitrag in den Zeiten des epochalen Wandels sehen, in denen wir leben: so etwas wie moderne Schamanen zu sein in der Erkundung der Frage „wie lebt man?“. Das war in den letzten Tagen des Februars 2020 – übrigens ein Schaltjahr.
Dann, nur ganz wenige Tage später und mit exponentiell zunehmender Unbezweifelbarkeit, kam die einstweilen so benannte Coronakrise über uns – ausgelöst durch den Entwicklungsprozess eines winzigen viralen Etwas, das wahrscheinlich mit niemand von uns ein persönliches Problem hat. Diese Krise hatte zwar schon seit zwei Monaten an die Pforten unserer Wahrnehmung geklopft, seit gut vier Wochen jedoch fällt es immer schwerer, die Augen vor ihrer schrillen und schrecklichen Realität zu verschließen. Sie fordert uns alle heraus. Als Individuen wie als Gemeinschaften, in unseren öffentlichen und unseren privaten Beziehungen, in unser aller globaler Matrix von Interessen, Interdependenzen und der Konkurrenz um den Zugriff auf Ressourcen.
Wir alle sind hin- und hergerissen zwischen rabiatem Egoismus und Hingabe in unserer Fürsorge für andere, und wir merken es stündlich, täglich, überall, immer drastischer, immer brisanter. Das heißt: wir alle sind unentrinnbar Teil eines kollektiven Langzeit-Prozesses, der sich akut exponentiell entfaltet, der uns bewirkt und den wir bewirken. Und wir sind noch lange nicht am Ausgang oder auch nur Höhepunkt der pandemischen Krise. Wir merken es daran (wenn schon nicht durch die schnöde Würdigung der Tatsachen), dass die Konflikte eskalieren.
Unsere inneren Konflikte zwischen Person und Rolle – als Person haben wir das Bedürfnis, unsere Mutter zu sehen, aber als Verantwortliche für das Wohl unserer Kinder und unserer Mutter dürfen wir das nicht. Zwischen unseren Bedürfnissen und unseren Verpflichtungen – Kontakt vermeiden ist im Augenblick ein Ausdruck von Liebe und Mitmenschlichkeit, Kontakt suchen oder provozieren ist übergriffig, kaltherzig und rücksichtslos. Äußere Konflikte verschärfen sich um uns herum und überall, vom Supermarkt bis zur Börse, den supranationalen Organisationen und sonst wo hin.
Es ist vollkommen klar: wir alle sind an Grenze 2 eines epochalen Transformationsprozesses. Alle Symptome, die wir eben aufgezählt haben, sind ‚klassische‘ Grenzsignale an Grenze 2, der Grenze gegen die Information: die Nerven liegen allseits blank. Irgendwas sehr Großes geschieht uns, aber was ist es genau, und wie heißt es? ‚Coronakrise‘ ist, so helfe uns Gott, hoffentlich nur eine prekäre und vorläufige Namensgebung, denn sie tut nichts anderes, als der komplexen und höchst dynamischen Symptomatik eine scheinbar ‚sachliche‘ Substantivierung aufzukleben. Typisch Grenze 2.
Wir können überhaupt noch nicht wissen, wie die transformatorische Bestie heißt, die uns konfrontiert. Dafür müssen wir sie erst kennenlernen und studieren. Je voreiliger wir sie benennen, desto beschränkter wird unsere Antwort sein. Denn auch dieser Eindruck ist unabweisbar, typisch Grenze 2: was uns geschieht, was uns konfrontiert, wird mit größtmöglicher Widerwilligkeit als Störung quittiert. Die innere und äußere Auseinandersetzung über sie ist noch sehr von der Sehnsucht getrieben, dass alles wieder so wird, wie wir es kannten, wenn die Störung erst einmal beseitigt sein wird.
Ein Medikament wird entwickelt, wir werden immun, die Wirtschaft brummt wieder, die ‚Märkte‘ lachen. Nichts für ungut!
Und gleichzeitig akkumulieren sich unterschwellige Beunruhigungen und Befürchtungen, Ahnungen und Intuitionen, dass es eben nie mehr so wird wie es mal war, und dass dies erst der tastende Beginn einer individuellen und kollektiven, wirklich globalen Auseinandersetzung ist, für deren Ausgang es kein Vorbild, keinen Vorgänger gibt. Epochal eben.
Tatsächlich muss man einige Jahrhunderte zurückgehen, zum Beginn der Epoche, deren Ende wir womöglich jetzt erleben, um so etwas wie einen Vorläufer für unsere aktuelle Herausforderung zu identifizieren:
nach London im Jahr 1665, zur „großen Heimsuchung“ durch den schwarzen Tod, die Pest, so wie sie etwa von Daniel Defoe fiktionalisiert beschrieben wurde.
Es gab krasse Parallelen zur heutigen Situation: die öffentliche Sphäre implodierte, die Armen wurden zum Teil bei lebendigem Leibe in Massengräber gekippt, die Reichen zogen sich auf ihre Landgüter zurück.
Weltuntergangsfantasien hatten natürlich Hochkonjunktur, und wie heute gab es Gewerbetreibende, die mit diesen Endzeit-Ängsten (oder auch -Sehnsüchten) Geld verdienten.

Unsere gegenwärtige Heimsuchung unterscheidet sich zu der am Beginn der Aufklärung am schrillsten darin, dass sie buchstäblich innerhalb weniger Wochen den ganzen Erdball erfasst hat, die allermeisten Menschen überall, wenn auch nicht auf uniforme Art und Weise. Und das ist, wenn überhaupt, dann Anlass für noch größere Sorge: wir können nicht weglaufen, nicht mal, wenn wir ganz stinkereich sind. Und wir können auch keinen Beistand holen, um die Krankheit nicht zu verbreiten.
Was also tun, im Angesicht der Krise unserer überkommenen Antwort auf die Frage "wie lebt man"?
Diese Punkte drängen sich auf, während wir Autor*innen in selbstgewählter Isolation auf Computerbildschirme starren:
- Verbunden bleiben. Ist es nicht wundersam, dass die freundliche Seite des Internets wieder erlebbar und nützlich ist?
-
Physischen Abstand halten. Das Alleinsein suchen und pflegen. Das Privileg feiern, sich überhaupt absondern zu können.
Das hilft sehr beim - Wesentlich werden. Aus der Alltagstrance aussteigen, anhalten und verlangsamen, sich fragen, was wirklich zählt.
- Kreativ werden. Unsere Kreativität ist ganz akut gefragt, und sie findet statt, wenn man allein mit dem Universum ist. „Not“, sagte man früher, „macht erfinderisch“.
- Helfen. Das, was wir geben können, dort zur Verfügung stellen, wo es gebraucht wird, auch, wenn es schräg und unorthodox ist. „Auf jeden Topf“, sagte man früher, „passt ein Deckel“.
Das alles können wir tun in der Gewissheit, dass das, was wir jetzt erleben, so gruselig es auch ist, nicht das Ende der Welt ist.
Es ist nur das Ende der Welt, wie wir sie kennen.
Das ist ehrfurchtgebietend genug, denn es fordert uns in jeder Beziehung und in allen Beziehungen. Aber, und wir Autor*innen notieren dies, während wir über den Rand unseres Computermonitors hinaus aus dem Fenster in die sonnengeflutete Welt blinzeln: es ist unabweisbar Frühling auf der nördlichen Erdhalbkugel. Das Leben sprießt allerorten. Eine dicke Elster baut ihr Nest auf einer Tanne, in der Nachbarschaft krakeelen kleine Kinder beim Spiel, das Leben behauptet und erneuert sich im nächsten Zyklus. Und in den Medien können wir täglich sehr anschaulich verfolgen, wie schnell sich die Natur wieder Lebensraum erschließt, wenn wir sie auch nur halbwegs in Ruhe lassen.
Hören wir den Weckruf?

Kommentar schreiben
Irene (Mittwoch, 01 April 2020 17:16)
Danke für diese Gedanken. Es ist wirklich eine sonderbare Mischung einer gemeinschaftlichen Wandlung, die man in erster Linie völlig privat erfährt...
Peter Bollmann (Freitag, 03 April 2020 18:25)
... wenn man das Privileg hat, über eine Privatsphäre zu gebieten ...